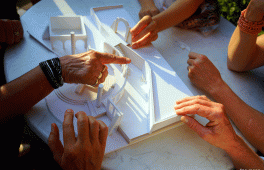MIZ: Von Herrn Höppner als Generalsekretär des Deutschen Musikrats wissen wir, dass er eine große Affinität zur Musik hat. Herr Dusel, wie ist es bei Ihnen persönlich?
DUSEL: Musik ist in meinem Leben zentral. Ich habe das absolute musikalische Gehör und habe schon mit vier Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Auf der Musikschule in meiner Heimatstadt Mannheim habe ich erst eine klassische Ausbildung erhalten und dann viel Jazz gespielt. Ich hatte tolle Lehrer, die den Unterricht auf mich zugeschnitten haben; ich konnte wegen meiner Sehbehinderung ja keine Noten lesen und musste trotzdem Bach spielen.
In meiner Schulzeit habe ich dann in vielen Formationen gespielt und ganz unterschiedliche Musik gemacht. So wurde Musik mein Zugang zur Inklusion. Das gemeinsame Musizieren hat Kommunikation ermöglicht; darüber habe ich die Normalität kennengelernt. Ich glaube, ohne die Musik wäre ich jetzt nicht hier.
MIZ: Das Motto Ihrer Amtszeit heißt „Demokratie braucht Inklusion“. Welchen Raum nimmt darin die Musik ein?
DUSEL: Ich glaube, dass ein buntes, diverses und damit auch inklusives Musikleben eine große Bereicherung für unser Land ist. Darum braucht Musik auch Demokratie, denn ich glaube, dass sich Musik so besser entwickelt als in hierarchischen, autokratischen Staaten. Das miteinander Musizieren auf Augenhöhe ist eigentlich etwas Demokratisches, ein Geben und Nehmen.
MIZ: Herr Höppner, welche Bedeutung hat Inklusion für das Musikleben?
HÖPPNER: Die Einladungskultur und damit auch der inklusive Charakter sind ganz stark mit der Musik verbunden. Wie Herr Dusel spielte ich während meiner Schulzeit in einer Band, in der auch Menschen mit einer Behinderung waren. Das haben wir aber gar nicht als etwas Besonderes wahrgenommen. Wir haben nur gemerkt, was für ein Schatz es ist, mit Menschen, die dafür Interesse haben, zusammen zu musizieren.
In Hinblick auf die Gesellschaft müssen wir nun vor allem ins Handeln kommen. Menuhin hat das mal so schön gesagt: „Die Musik spricht für sich allein – vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.“ Diese Chance hat jeder Mensch nicht nur verdient, sondern sie muss eine Selbstverständlichkeit sein – und dies bestmöglich in der Vermittlung aber auch bestmöglich bei den Rahmenbedingungen, da hapert es noch.
MIZ: Dann sprechen wir über das Handeln. Herr Dusel, Sie kümmern sich um die Belange von Menschen mit Behinderungen, vom Wohnen über Gesundheit bis zur Digitalisierung. Wo ist da die Musik angesiedelt?
DUSEL: Wir haben bei uns im Team eine Referentin und einen Referenten, die für das Thema Kultur zuständig sind. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir mit Kultur Menschen erreichen können, die wir mit Politiksprech nicht mehr erreichen können. Als eigene Veranstaltung haben wir das Projekt „Kultur im Kleisthaus“ etabliert, das ausdrücklich inklusiv ist.
Ich versuche, die Themen, die ich forciere, im Bereich der Kultur zu spiegeln. Wenn wir beispielsweise über Erinnerungskultur reden, spreche ich im Salon im Kleisthaus mit Claudia Roth und Igor Levit darüber. Wenn wir etwas zum Thema Menschen mit Lernbeeinträchtigung machen wie bei den Special Olympics, machen wir auch etwas Entsprechendes im Kulturbereich.
Zusammen mit dem Deutschen Kulturrat führen wir außerdem Workshops durch, die das Ziel haben, der Bundesregierung Teilhabeempfehlungen zu geben.
HÖPPNER: Diese Workshops sind Gold wert für unsere Community, nicht zuletzt, weil sie uns helfen, Lücken zu erkennen. Unter den Teilnehmenden waren auch Kultureinrichtungen, die erst jüngst eröffnet worden waren und die stolz auf ihre behindertengerechte Ausstattung waren. Gemeinsam mussten wir lernen, dass sie gar nicht so barrierefrei sind, wie sie glaubten.
MIZ: Welche Rahmenbedingungen sind für das Thema Inklusion im Kulturbereich wichtig?
HÖPPNER: Zentral ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Damit haben wir erstmals ein Regelwerk, das einklagbar ist. Daneben haben wir für die Argumentation noch andere wertvolle Papiere, darunter die UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von 2005 und die UNESCO-Konvention von Mexiko City Mondiacult von 2022, in der Kultur erstmals als „globales öffentliches Gut“ bezeichnet wird. Wir dürfen aber nicht nur auf die juristische Normierung setzen, sondern wir müssen das Bewusstsein verändern. Welche Chancen bietet Inklusion unserer Gesellschaft?
DUSEL: Es geht dabei im Übrigen nicht um etwas Nettes oder ein Nice-to-have, sondern um etwas Urdemokratisches. Der Staat hat nicht nur die Pflicht, Recht zu setzen, also beispielsweise die UN-Behindertenrechtskonvention zu ratifizieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass diese Rechte bei den Menschen ankommen.
MIZ: Eine Initiative, die genau dies möchte, ist die neue Bundesinitiative Barrierefreiheit. Welche Chancen ergeben sich daraus für den Kulturbereich?
DUSEL: Die Koalitionsfraktionen haben im Koalitionsvertrag vieles verabredet, und jetzt geht es darum, dies auch umzusetzen. Da müssen wir, musikalisch gesprochen, ein bisschen ins Presto kommen, denn zurzeit ist das alles noch sehr Lento. Die Bundesinitiative Barrierefreiheit ist ein Schlüssel, auf den nun Taten folgen müssen. Das bedeutet für den Bereich Kunst und Kultur unter anderem, die Förderstrukturen so zu entwickeln, dass sie möglichst vielen Menschen zugutekommen. Das fängt schon bei den Jurys an. Wer entscheidet, wohin Fördermittel gehen? Wie setzen sich die Gremien zusammen? Wir sprechen zurecht über Diversity, reden dabei aber vor allem über die Herkunft von Menschen oder Gender – und noch zu wenig über das Thema Behinderung.
Wir müssen Menschen mit Behinderung auch ermutigen. Es geht ja nicht nur um sie als Publikum, sondern auch darum, dass sie ihre künstlerische Kreativität einbringen und auf der Bühne zeigen können. Dazu bin ich auch mit Claudia Roth im Austausch.
MIZ: Eine Voraussetzung für mehr künstlerische Teilhabe von Menschen mit Behinderung dürfte der Zugang zu musikalischer Bildung sein. Herr Höppner, können Schulen dafür der geeignete Ort sein?
HÖPPNER: Da sprechen Sie ein düsteres Kapitel an. In den Schulen haben wir eine desaströse, defizitäre Situation. In den Grundschulen fällt ausweislich einer Studie, die wir als Musikrat zusammen mit den Landesmusikräten und der Bertelsmann Stiftung gemacht haben, bis zu 70 Prozent des Musikunterrichts aus, also an einem Ort, an dem wir Kinder am allerbesten erreichen, und dies in einem Alter, das wirklich eine Prägephase ist. Ich bin ein großer Anhänger des Föderalismus, aber hier wird seitens der Länder eine Chance vertan – sowohl, was Schule als Willkommensort ausmacht als auch, was die Lehrpläne angeht. Ich setze deshalb große Hoffnung auf die noch recht junge Kulturministerkonferenz, sich innerhalb der Kultusministerkonferenz für einen höheren Stellenwert von Musik und Kultur in der Bildung zu engagieren.
MIZ: Welche Rolle spielt die Thematik im Deutschen Musikrat?
HÖPPNER: Innerhalb unserer Community haben wir das Glück, dass von den 109 Mitgliedsverbänden des Deutschen Musikrats etliche dabei sind, deren Vertreter*innen ein hohes Bewusstsein für das Thema Inklusion haben. Das fängt bei Einzelpersonen wie Werner Probst an, der sich schon Ende der 1970er Jahre für Inklusion an den öffentlichen Musikschulen eingesetzt hat, und setzt sich mit Irmgard Merkt fort. Es geht aber darum, dies noch stärker zusammenzubinden und im politischen Raum zu platzieren, im Bundestag, in den Koalitionen, und klarzumachen, dass wir es nicht mit Partikularinteressen zu tun haben, sondern mit einem gesamtgesellschaftlichen Interesse.
Für den Bereich Demenz haben wir schon einen Vorstoß gemacht. Im September 2022 haben wir auf Initiative des Landesmusikrats Hamburg gemeinsam mit der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik die „Bundesinitiative Musik und Demenz“ auf den Weg gebracht. Mittlerweile sind wir auch Mitglied des Netzwerks Nationale Demenzstrategie der Bundesregierung.
Für diese Themen wollen wir auch noch einen Überbau schaffen. Das Präsidium des Deutschen Musikrats hat jüngst beschlossen, das kommende Jahr 2024 unter das Motto „Musik und Gesundheit“ zu stellen, und so hoffe ich, dass wir da gemeinsam noch sichtbarer werden.
MIZ: Wo ist das Thema Inklusion in den Musikverbänden angesiedelt? Die öffentlichen Musikschulen und damit den Verband Deutscher Musikschulen (VdM) haben Sie schon genannt, aber wo steht das Thema in der Breite?
HÖPPNER: Der VdM ist eine Ausnahme, weil er Inklusion schon seit über 40 Jahren praktiziert. Bei vielen anderen erhält das Thema erst in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit. Da ist noch viel zu tun. Bei unseren eigenen Projekten hat das Bundesjugendorchester eine beispielgebende Maßnahme durchgeführt. Zusammen mit hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern des BZZ Stegen ist das Orchester in die Welt von Beethovens Dritter Sinfonie eingetaucht. Als Beethoven diese Sinfonie komponierte, litt er schon unter massivem Gehörverlust. Die Sinfonie wurde kontrastiert mit der Uraufführung eines eigens für das Projekt geschriebenen Werkes von Mark Barden, in dem ungewöhnliche Materialien und Werkzeuge zum Einsatz kamen, um die Welt der Klänge auch Hörgeschädigten erlebbar zu machen. Dadurch wurde deutlich: Musik kann auch mit anderen Sinnen als (nur) dem Hörsinn erfahrbar sein. Mit solchen Projekten versuchen wir unseren Mitgliedern und einem breiten Publikum zu zeigen, dass Inklusion nicht nur in theoretischen Abhandlungen stattfinden kann, sondern durch die musikalische Praxis zu beglückenden Erfahrungen führt.
In ähnlicher Weise verstärken wir auch unsere Bemühungen im Bereich Hören mit allen Sinnen. Das ist ein Thema, das insgesamt noch unterentwickelt ist, auch in unseren Mitgliedsverbänden. Ich kann Musik sehen, ich kann Musik fühlen, ich kann Musik riechen und, und, und. Dazu arbeiten wir mit der Initiative Hören, die von Karl Karst geleitet wird, zusammen.
MIZ: Herr Dusel – mit Blick auf Förderprogramme: Ist das Thema Inklusion dort schon hinreichend vertreten?
DUSEL: Nein, und das muss sich ändern. Es gibt schon gute Beispiele wie das Musicboard Berlin, und auch innerhalb der BKM zeigt sich eine große Bereitschaft, inklusive Förderkulissen zu entwickeln. Insgesamt fehlen aber Systematik und Struktur, auch im kommunalen Bereich. Das hat auch damit zu tun, dass wir im Kunst- und Kulturbereich das Thema Inklusion oft defizitär betrachten. Viele sehen eher, was nicht funktioniert und erkennen nicht, dass wir unheimlich viel Talent verschenken.
Für mich ist Felix Klieser ein Beispiel dafür, was da eigentlich möglich ist. Obwohl er ohne Arme geboren wurde, ist er einer der größten Hornisten geworden. Ich finde seine Geschichte sehr berührend. Mit vier Jahren hat er den Wunsch geäußert, Hornist zu werden, und wurde darin von seinen Eltern bestärkt. Den Weg ist er dann konsequent weitergegangen, trotz aller Schwierigkeiten bei seiner Ausbildung.
Ein anderes Beispiel ist Graf Fidi, den mein Team und ich bei der Produktion eines Songs unterstützt haben: „Wer ist schon normal?“ Uns muss klar sein, dass Menschen mit Beeinträchtigung Unglaubliches leisten können und unsere Gesellschaft reicher machen. Dabei geht es nicht darum, Abstriche bei der Qualität zu machen, sondern es geht darum, noch besser zu werden. Das setzt voraus, dass möglichst viele Menschen dazugehören.
MIZ: Das setzt auch voraus, dass Menschen Zugang zu Ausbildungen haben. Was muss da bei den künstlerischen Hochschulen passieren?
DUSEL: Es geht vor allem darum, Nachteilsausgleiche zu gewähren und Lehrinhalte anders zu präsentieren. Vor einiger Zeit habe ich darüber mit der Rektorin der Hochschule Ernst Busch gesprochen und gemerkt, dass es hier durchaus die Bereitschaft zu Veränderungen gibt, aber an den Hochschulen herrscht insgesamt noch ein etwas konservatives Bild vom Menschen. Wir haben zwar den KMK-Beschluss „Eine Hochschule für Alle“, aber zwischen dem, was auf dem Papier steht, und dem, was umgesetzt wird, besteht noch ein Gap.
HÖPPNER: Das bemängelt auch der Verein Eucrea, der zusammen mit Berliner Hochschulen testet, wie das Studium inklusiver werden kann. Die Rektorenkonferenz der Musikhochschulen hat sich in diesem Sommer auch noch einmal mit dem Thema befasst.
MIZ: Ein Problem, das verhindert, dass mehr Menschen mit Behinderung auf Bühnen zu erleben sind, liegt darin, dass dies den Menschen oft nicht zugetraut wird. Braucht es hier einen Perspektivwechsel? Die Diskussion erinnert ein bisschen an frühere Debatten über Frauen in Orchestern oder schwarze Sänger auf der Opernbühne. Lässt sich daraus lernen?
DUSEL: Die Frage beantwortet sich von allein. Ich glaube, dass wir so früh wie möglich Begegnungen schaffen müssen – Stichwort gemeinsames Lernen an Schulen –, damit Vorurteile gar nicht erst entstehen. Denn dann bestehen auch keine Vorurteile, wenn sich Menschen mit Beeinträchtigung für die Bühne bewerben.
Den Perspektivwechsel, der dafür nötig ist, kann man allerdings nicht von politischer Seite verordnen. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Aufgabe des Staates ist es jedoch, diesen gesellschaftlichen Prozess nicht sich selbst zu überlassen, sondern ihn anzuschieben und deutlich zu machen, dass es um die Umsetzung von Grundrechten geht. Es geht um das Recht auf Arbeit, es geht um das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung.
MIZ: Perspektivwechsel auf der Bühne, Herr Höppner, wie weit sind wir da?
HÖPPNER: Da schaue ich einmal in den Orchestergraben und auf die Bereitschaft, unter Umständen die Orchesteraufstellung zu ändern. Um die Orchesteraufstellung werden Glaubenskämpfe ausgetragen – wo sitzen die Celli, wo sitzen die Bratschen? Hier Veränderungen zuzulassen, könnte nicht nur mehr Möglichkeiten für Inklusion, sondern auch neue Klangerlebnisse bringen.
Die Coronazeit hat uns das eigentlich vorgemacht, weil da auf einmal große Abstände gefordert waren. Da haben die Musikerinnen und Musiker plötzlich gemerkt, was möglich ist und was daran auch reizvoll sein kann. Natürlich hat man im Orchestergraben in Bayreuth nicht viel Spielraum, aber das ist nicht die Blaupause. Eher geht es um die Frage, mit welchen Einstellungen die Kolleginnen und Kollegen an die Sache herangehen.
DUSEL: Wichtig wäre auch, Menschen mit Behinderungen in die Konzepte einzubinden. Es gibt spannende Theaterstücke, in denen Menschen, die die Gebärdensprache als Muttersprache nutzen, Teil des Ensembles sind und es keine Gebärdensprachdolmetschung am Rande gibt. Da gibt es noch viel Potenzial.
MIZ: Wenn wir von den öffentlich geförderten Theatern einmal zu den privaten Spielstätten blicken – wie sieht es dort aus? Mit der Barrierefreiheit scheint es da noch zu hapern. Welche Maßnahmen ließen sich ergreifen?
DUSEL: Mein Ziel ist, die privaten Spielstätten zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Für den öffentlichen Bereich haben wir dafür bereits Gesetze, für den privaten Bereich bei Anbietern von Produkten und Dienstleistungen noch nicht. Im Koalitionsvertrag steht, „wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens barrierefrei wird“. Ich bin der Meinung, dass wir dafür das Grundgesetz als Grundlage nehmen müssen. Dort heißt es in Artikel 14, dass das Eigentum gewährleistet ist mit dem berühmten Absatz 2 (und das ist die Sozialbindung): „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Damit muss aber auch wirklich die Allgemeinheit gemeint sein, inklusive der 13,5 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung. Das heißt konkret: Ich möchte nicht, dass ein kleiner Club schließen muss, weil er im Keller liegt und barrierefrei nicht zu erreichen ist. Aber ich möchte schon, dass die Entwicklung von Förderungen grundsätzlich an die Barrierefreiheit geknüpft wird.
HÖPPNER: Das bedeutet aber auch, öffentliche Mittel als Fördermaßnahmen bereitzustellen, um die Bandbreite kultureller Vielfalt erhalten zu können.
DUSEL: Ja, natürlich, ich möchte nichts im Bestand kaputtmachen. Aber in Förderbescheiden muss grundsätzlich die Barrierefreiheit berücksichtigt sein, damit Förderbescheidempfängern klar wird, dass dies ein wichtiger Punkt ist. Wenn Barrierefreiheit nicht zu erreichen ist, muss dies begründet sein. Bei Fördermitteln handelt es sich um Steuergeld, das auch von Menschen mit Beeinträchtigung erwirtschaftet wird. 1,35 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung haben ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Dieses Geld muss auch zurückfließen. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Barrierefreiheit ein Nice-to-have ist, und hinkommen zu der Idee, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsmerkmal für eine moderne Struktur und damit auch für eine moderne Kunst- und Kulturstruktur ist.
MIZ: Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal einen Blick auf die gesellschaftliche Relevanz von Inklusion, aber auch von Kunst und Kultur insgesamt werfen. Herr Höppner, warum ist die Förderung von Kunst und Kultur gerade jetzt wichtig?
HÖPPNER: Wir leben in Zeiten von Spannungen, in denen verschiedene gesellschaftliche Gruppen einander nicht mehr gut zuhören können. Da können Kunst und Kultur wesentliche Brücken bauen, aber auch für Indoktrination und Manipulation verwendet werden. Diese Janusköpfigkeit von Kultur ist mir wichtig noch einmal zu unterstreichen.
In ihrer Brückenfunktion sind Kunst und Kultur wesentliche Instrumente, eine Gesellschaft menschenfreundlicher zu gestalten. Dieses Bewusstsein müssen wir noch stärker an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger herantragen und dafür sorgen, dass in diesen Bereichen stärker investiert wird. Das ist eine Bewusstseinsfrage, aber auch eine Rahmengesetzgebungsfrage und eine Finanzierungsfrage.
Kunst und Kultur müssen dabei allen zugänglich sein. Als Musikrat müssen wir hier zum einen oben ansetzen, zum anderen aber auch Neugierde und Nachfrage unten schaffen, und damit meine ich keine Hierarchisierung. Das Oben beschreibt etwa die Potsdamer Erklärung des VdM, das Unten ein Projekt wie Zusammen(ge)hören des Bundesjugendorchesters. Die Berührung mit dem Thema ist das Essential, um Veränderungen zu bewirken.
MIZ: Herr Dusel, warum ist Inklusion wichtig für die Gesellschaft, aber auch für die Kunst- und Kulturszene?
DUSEL: Wir leben in Deutschland in einer sich stark wandelnden demographischen Gesellschaft. Es geht also auch um Kundinnen und Kunden und die Frage, wer ins Konzert, in die Oper oder aufs Rockmusikfestival geht. In Deutschland leben 13,5 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung, und die leben nicht alleine. Die haben Freunde, Eltern, Partner, Kinder. Nur drei Prozent von ihnen werden mit einer Behinderung geboren, der Rest erwirbt die Behinderung im Laufe des Lebens, meistens im Alter. Komischerweise diskutieren wir leidenschaftlich über Inklusion im Schulbereich, aber für mehr als 90 Prozent der Menschen mit Behinderung spielt das überhaupt keine Rolle.
Wenn diese Menschen nun nicht in die Oper oder auf ein Konzert kommen können, weil es dort Barrieren gibt oder weil es so mühsam ist, dorthin zu gelangen, sind nicht nur sie betroffen, sondern auch deren Familie und Freunde. Wir reden also über eine sehr große Gruppe. Deshalb können wir es uns im Kunst- und Kulturbereich überhaupt nicht erlauben, auf Barrierefreiheit zu verzichten, auch aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen nicht. Konzerthäuser, Clubs und Festivals sind also gut beraten, sich darauf einzustellen. Und dazu muss man klar sagen: Es ist nicht damit getan, eine Rampe zu bauen, es fängt bei der Kommunikation an. Wenn eine Homepage nicht barrierefrei ist, bin ich als sehbehinderter Mensch sofort ausgeschlossen und gehe im Zweifel woanders hin – und meine Familie übrigens auch.
Menschen, die ihr Leben lang ins Konzert oder Theater gegangen sind, müssen dies auch im Alter und mit einer Beeinträchtigung tun können. Wir haben eine Verantwortung, dafür Zugänge zu ermöglichen und hier ist Barrierefreiheit der Schlüssel. Ich wünsche mir, dass dies zur Chefinnen- und zur Chefsache wird. Ein Intendant oder ein GMD sollte das als sein Thema betrachten, es sollte zur Corporate Identity eines Hauses werden.
Kunst und Kultur sind für unsere Demokratie absolut wesentlich. Daher ist es nicht nur eine Frage der Fairness, dass Menschen mit Behinderung Zugänge haben, sondern es ist eine Frage der Demokratie.
Das Interview fand am 26. Oktober 2023 statt. Die Fragen stellte Dr. Karin Stoverock.